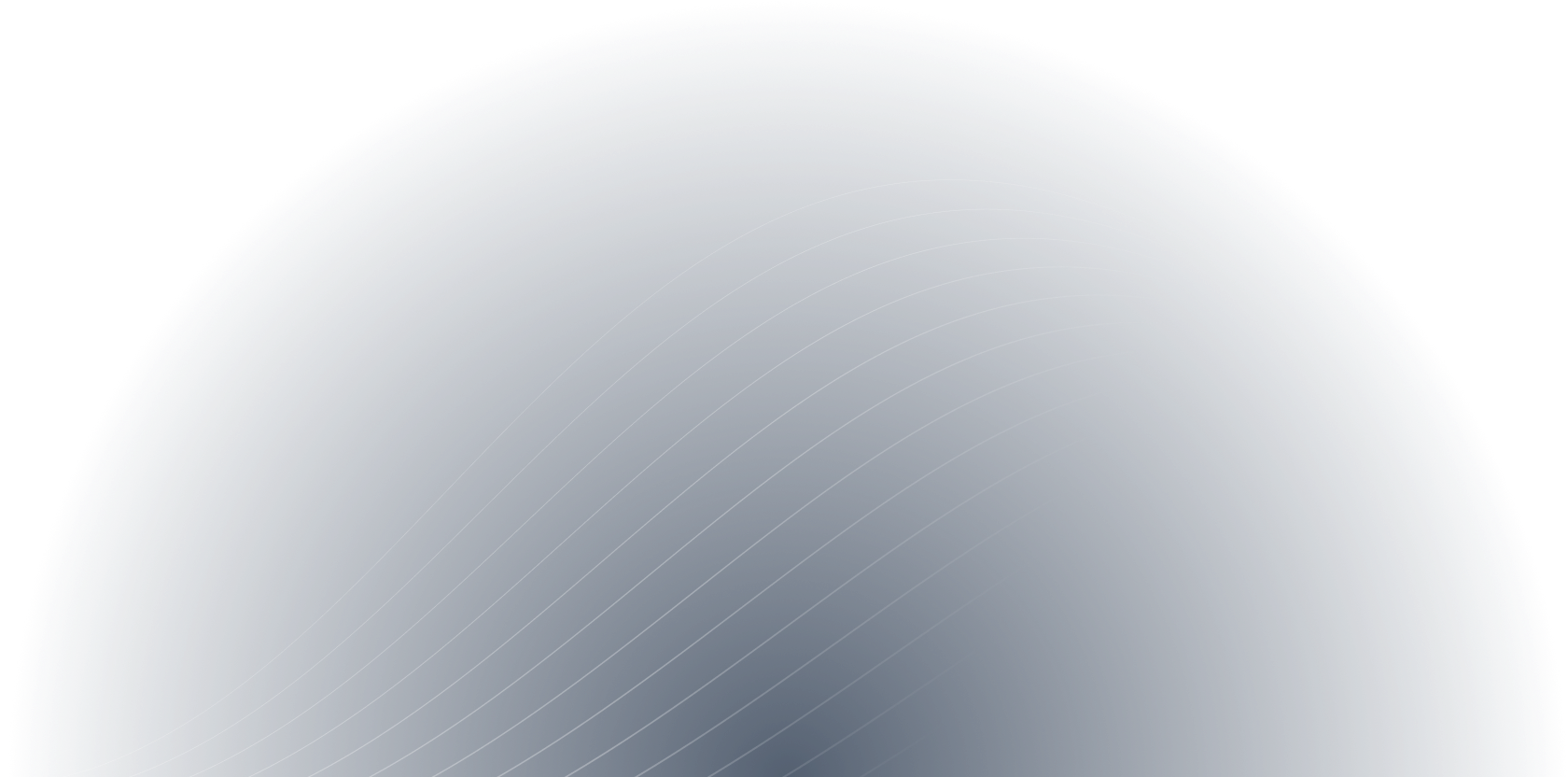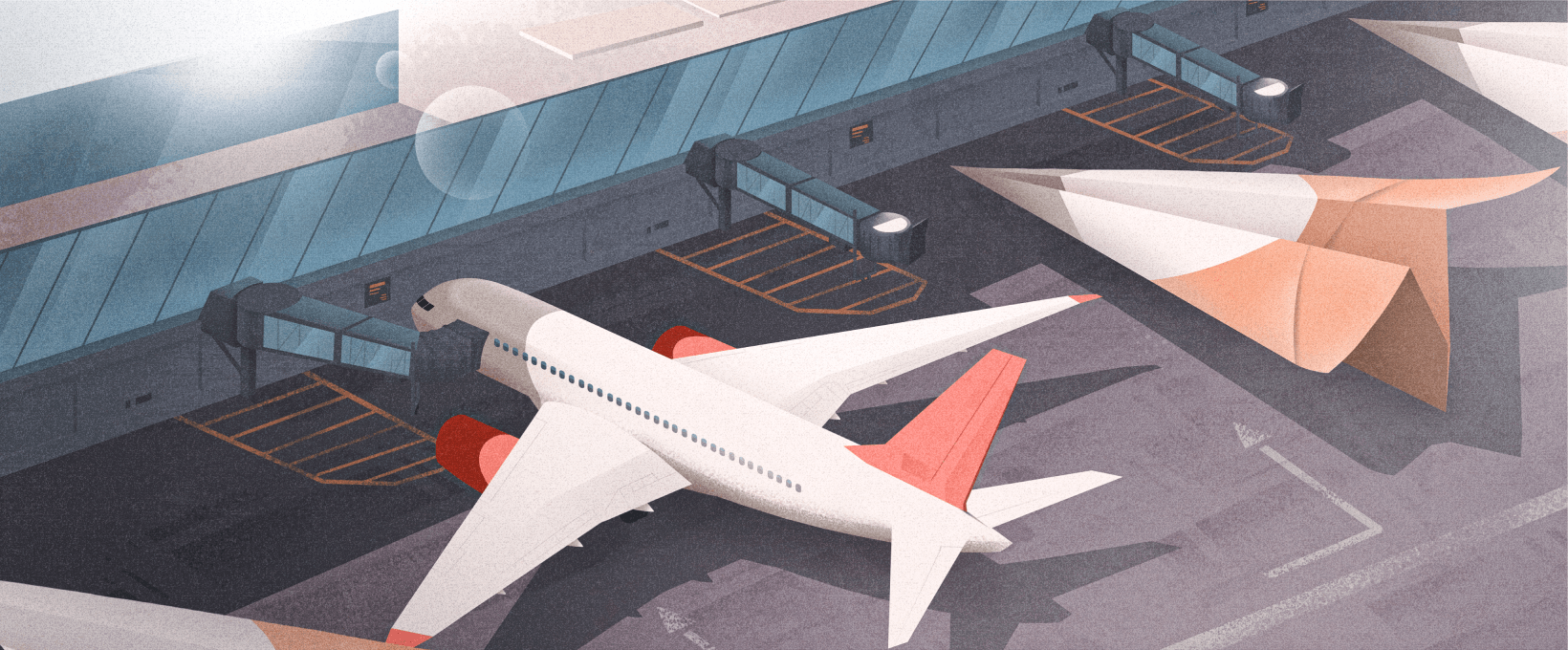- Warum Softwareprojekte manchmal gerettet werden müssen
- Anforderungen und Umfang
- Planung und Schätzung
- Steuerung und Kommunikation
- Teamzusammensetzung und Kompetenzen
- Unproduktive Entwicklungspraktiken
- Risikomanagement
- Risiken für Softwareprojekte: Übliche Warnsignale
- Drift bei Umfang und Anforderungen
- Planung, Schätzung und Umsetzung geraten ins Rutschen
- Kennzahlen geraten aus dem Blick
- Kommunikation, Steuerung und Reibungen zwischen Stakeholdern nehmen zu
- Stimmung und Leistungsfähigkeit nehmen ab
- Technische Qualität nimmt ab
- Probleme werden zu spät oder gar nicht gemeldet
- Strategie zur Rettung von Softwareprojekten
- Schritt 1: Diagnose
- Schritt 2: Stabilisierung
- Schritt 3: Wiederherstellung
- Schritt 4: Prävention
- Softwareprojekt gescheitert? Retten Sie Ihre Lösung mit Andersen
Laut dem Project Management Institute muss fast jede Organisation irgendwann ein Softwareprojekt retten. Ganz gleich, ob es sich um Web- oder mobile App-Entwicklung handelt: Mehr als 70 % aller IT-Vorhaben geraten in ernsthafte Schwierigkeiten oder scheitern sogar komplett. Wer in solchen Situationen frühzeitig Maßnahmen zur Rettung von Softwareprojekten ergreift, kann große Verluste vermeiden.
Warum Softwareprojekte manchmal gerettet werden müssen
Softwareprojekte scheitern oft an Umfang, Zeit oder Budget. Ein einfacher Blick auf „erfolgreich oder gescheitert“ reicht nicht aus. Viele digitale Initiativen enden in einer Grauzone – verspätet, zu teuer oder mit geringerem Nutzen als geplant.
Ein einzelner Fehler ist selten der Grund für Probleme. Wenn ein Softwareprojekt gescheitert ist, liegt das meist daran, dass sich kleine Schwächen im Laufe der Zeit summieren und gegenseitig verstärken.
Anforderungen und Umfang
Oft startet eine IT-Initiative, ohne dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis von „Erfolg“ haben. Grobe Ziele werden formuliert, detaillierte Akzeptanzkriterien bleiben aber aus. Im Laufe des Projekts verschieben sich die Ziele, der Backlog wächst und Prioritäten geraten durcheinander.
Planung und Schätzung
Zu viel Optimismus führt in vielen Projekten in die Sackgasse. Termine werden festgelegt, bevor alle Risiken klar sind. Es fehlen dabei Puffer. Wenn ein Meilenstein ausfällt, versucht man, später aufzuholen. Das erzeugt steigende technische Schulden.
Steuerung und Kommunikation
Selbst starke Teams stolpern, wenn Entscheidungen fragmentiert fallen. Kritisches Feedback von Business-Sponsoren, Delivery Managern und Entwicklern kommt oft zu spät, und Probleme bleiben zunächst verborgen – bis sie in späteren Phasen eskalieren.
Teamzusammensetzung und Kompetenzen
Eine weitere Schwäche ist eine unausgewogene Teamstruktur. Erfahrene Architekten, SRE-Spezialisten oder QS-Leads fehlen oft. Als Ergebnis werden Integrations- und Performanceprobleme spät erkannt. Hohe Fluktuation und starke Abhängigkeit von Junior-Mitarbeitern verschärfen die Lücken. Wenn Wissen verloren geht, beschäftigt sich das Team oft mehr damit, alte Entscheidungen nachzuvollziehen, statt Fortschritt zu schaffen.
Unproduktive Entwicklungspraktiken
Unter Zeitdruck leidet die technische Sorgfalt. Continuous Integration und automatisierte Tests fehlen oft, Defekte häufen sich unbemerkt. Instabile Umgebungen, uneinheitliche Standards und manuelle Deployments verlangsamen die Auslieferung und treiben Wartungskosten. Mit der Zeit hängt das Projekt von technischer Schuld ab. Selbst kleine Änderungen können andere Bereiche beeinträchtigen.
Risikomanagement
Viele Organisationen behandeln Risiko-Logs eher als Pflicht. Probleme bleiben oft ungeklärt und Frühwarnsignale werden ignoriert. Es fehlt eine Kultur, die rechtzeitiges Eingreifen ermöglicht. Als Ergebnis wachsen Schwierigkeiten unbemerkt, und die Projektrettung wird schnell teurer als Prävention.
Risiken für Softwareprojekte: Übliche Warnsignale
Ein Projekt gerät meist schrittweise in Schwierigkeiten, ein kompletter Zusammenbruch kommt selten plötzlich. Wer die ersten Signale wahrnimmt, kann frühzeitig eingreifen.
Drift bei Umfang und Anforderungen
- Der Product Backlog wächst ständig durch neue Aufgaben, Erweiterungen oder ‚nice-to-have‘-Funktionen;
- Häufige „Notfall“-Anfragen umgehen die normale Priorisierung, oder kleine Wünsche tauchen in jedem Sprint auf;
- Akzeptanzkriterien bleiben unklar oder ändern sich während der Iteration. Neue Bedingungen, unbeabsichtigte Abhängigkeiten oder Randfälle tauchen mitten im Sprint auf;
- Entscheidungen darüber, was umgesetzt werden soll, verlaufen in endlosen Diskussionen, anstatt dass der Product Owner klare Vorgaben trifft.
Planung, Schätzung und Umsetzung geraten ins Rutschen
- Sprint-Ziele werden regelmäßig verfehlt. Zum Beispiel sagt das Team 10 Stories zu, schafft aber nur 6. Achten Sie außerdem darauf, ob Termine immer wieder verschoben werden;
- Meilensteine geraten ins Stocken, ohne dass die Ursachen klar sind, und Erklärungen wirken vage oder defensive;
- Aufgaben zu Integration, Qualität oder Infrastruktur werden immer wieder verschoben und bleiben von Sprint zu Sprint liegen;
- Puffer oder Reserven schwinden sichtbar. Das Management drängt auf Aufholphasen oder komprimiert spätere Sprints.
Kennzahlen geraten aus dem Blick
- Wichtige Kennzahlen werden oft gar nicht erfasst, nur unregelmäßig berichtet oder so dargestellt, dass alles „in Ordnung“ wirkt;
- Wenn Diagramme eine negative Entwicklung zeigen, fragt niemand nach den Gründen;
- Risiko-Register existieren zwar, bleiben aber passiv: Viele offene Risiken für Softwareprojekte werden nicht aktualisiert;
- Fehler oder Nacharbeiten häufen sich und übersteigen die Anzahl neu abgeschlossener Features.
Kommunikation, Steuerung und Reibungen zwischen Stakeholdern nehmen zu
- Es ist unklar, wer Entscheidungen treffen darf;
- Probleme bleiben ungelöst, Abhängigkeiten blockieren den Fortschritt, und Eskalationszyklen ziehen sich sichtbar in die Länge;
- Die Beteiligung der Stakeholder nimmt ab. Wichtige Sponsoren oder Nutzer erscheinen seltener bei Demos, verpassen Sprint-Reviews oder geben kein Feedback;
- Die Stimmung in Meetings wird zunehmend negativ.
Stimmung und Leistungsfähigkeit nehmen ab
- Überstunden werden zur Norm, und geplante, nachhaltige Arbeit kommt zu kurz;
- Die Stimmung sinkt. Teammitglieder zeigen weniger Engagement, ergreifen weniger Initiative oder reagieren passiv auf neue Herausforderungen;
- Fluktuation steigt, besonders unter erfahrenen Mitarbeitern. Dies schwächt das Projektwissen erheblich;
- Junior-Entwickler übernehmen kritische Aufgaben ohne ausreichende Anleitung oder Absicherung.
Technische Qualität nimmt ab
- Builds werden instabil und brüchig. Jede Änderung kann unerwartet andere Bereiche beeinflussen;
- Entwicklungsumgebungen driften auseinander, Deployments werden unberechenbar;
- Automatisierte Tests schlagen öfter fehl, die Testabdeckung schrumpft, und Debugging wird unverhältnismäßig aufwendig;
- Technische Schulden wachsen unbemerkt: Code-Smells, doppelte Logik und architektonische Kompromisse häufen sich. Jede neue Funktion wird dadurch teurer und riskanter.
Probleme werden zu spät oder gar nicht gemeldet
- Neue Risiken tauchen auf, werden aber erst eskaliert, wenn sie dringend werden;
- Puffer oder Reserven sind aufgebraucht, bleiben jedoch verborgen;
- Teams sprechen blockierende Probleme oft nicht an, aus Angst vor Vorwürfen;
- Im Nachhinein zeigt sich, dass das kritische Problem eigentlich vorhersehbar war.
Strategie zur Rettung von Softwareprojekten
Wenn Warnsignale zu erkennen sind, hilft reiner Optimismus nicht mehr. Führen Sie eine strukturierte Intervention durch. So könnte ein moderner Ansatz zur Rettung von Softwareanwendungen aussehen:
Schritt 1: Diagnose
Bevor konkrete Maßnahmen ergriffen werden, sollten Sie verstehen, was schiefgelaufen ist:
- Unabhängiges Audit aus technischer und Management-Perspektive: Überprüfung von Code, Architektur, Deployment-Pipelines, Testabdeckung, Backlog-Gesundheit, Kommunikation, Entscheidungen, Zeitplänen und Budgetverbrauch.
- Review der Business-Analyse-Artefakte: Durchsicht von Business Requirements Documents (BRD), Software Requirements Specifications (SRS), Use Cases und Akzeptanzkriterien.
- Interviews mit Stakeholdern: Einholen von Einsichten von Entwicklern, Qualitätssicherung, Operations, Product Ownern und Business-Sponsoren, um Missverständnisse und Problempunkte zu identifizieren.
- Ursachenanalyse: Anwendung von Fishbone-Diagrammen, Pareto-Priorisierung oder gewichteten Entscheidungstabellen, um die Kernursachen zu ermitteln.
- Bewertung der Rettbarkeit: Feststellen, ob das Projekt realistisch gerettet werden kann oder ob eine teilweise Rückabwicklung bzw. Beendigung verantwortungsvoller ist.
- Rettungsbericht als Teil der umfassenden Wiederherstellungsplanung: Zusammenfassung von 3–5 wesentlichen Fehlerursachen, Lücken zwischen Business und Technik, Kosten- und Zeitplanfolgen sowie einem vorgeschlagenen Rettungs- oder Abwicklungsplan.
Schritt 2: Stabilisierung
Sobald klar ist, was genau schiefläuft, handeln Sie am besten sofort:
- Umfang einfrieren: Keine neuen Features oder Erweiterungen, bis das Projekt stabilisiert ist.
- Kritische Fehler beheben und Abhängigkeiten lösen: Konzentrieren Sie sich auf Showstopper oder Engpässe, die den Fortschritt blockieren.
- Transparenz wiederherstellen: Gemeinsame Dashboards, ehrliches Reporting, tägliche Stand-ups, Demos und sichtbare Kennzahlen sind unverzichtbar.
- Governance neu strukturieren: Bestimmen Sie einen Leiter für Projektrettung, regeln Sie die Entscheidungsrechte klar und legen Sie die Eskalationswege fest.
- Schlüsselressourcen neu zuweisen: Binden Sie erfahrene Entwickler, Architekten, QS-Leads oder externe Berater ein, um Schwachstellen zu stärken.
- Kurzfristige Neuplanung: Stellen Sie einen schlanken, realistischen Wochenplan auf, der Fortschritte sichtbar macht.
Schritt 3: Wiederherstellung
Sobald das Projekt stabilisiert ist, können Sie mit der Wiederherstellungsphase beginnen:
- Umfang neu festlegen und priorisieren: Behalten Sie Features mit hohem Nutzen und streichen Sie weniger wichtige Funktionen von individuellen Softwarelösungen. Wenn der ursprüngliche Umfang unrealistisch ist, definieren Sie eine Minimalversion, die dennoch Mehrwert liefert. Passen Sie Anforderungen und begleitende Dokumentation an oder erstellen Sie sie neu.
- Technisches Refactoring und Bereinigung: Beginnen Sie damit, den Code modular zu gestalten, bestehende technische Schulden abzubauen und die Struktur zu verbessern. Gleichzeitig sollten Pipelines stabilisiert, Deployments automatisiert und die Testabdeckung sichergestellt werden. Abschließend gilt es, unterschiedliche Umgebungen anzugleichen und Konfigurationsabweichungen zu beseitigen. Damit schaffen Sie eine stabile Basis für die nächsten Entwicklungsschritte.
- Iterative Lieferung und Review-Zyklen: Bringen Sie kurze Sprints von ein bis zwei Wochen mit klaren, greifbaren Ergebnissen zurück. Regelmäßige Demos und frühes Feedback sind dabei unerlässlich. Lassen Sie Ihre Entscheidungen von empirischen Daten und funktionierenden Inkrementen leiten, statt starren Langzeitplänen zu folgen.
- Teamdynamik und Motivation wiederaufbauen: Führen Sie Retrospektiven durch, beseitigen Sie Hindernisse, feiern Sie kleine Erfolge und unterstützen Sie Ihre Mitarbeitenden, besonders Junioren, durch Coaching. Definieren Sie zudem Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse klar, um Orientierung und Sicherheit zu schaffen.
- Governance und Disziplin: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Teams Änderungen sofort stoppen, wenn Qualität oder Sicherheit gefährdet sind, und pflegen Sie Risiko-Register, vergeben Verantwortlichkeiten, definieren Gegenmaßnahmen und überprüfen diese wöchentlich. Verfolgen Sie Kennzahlen wie Velocity, Fehlertrends und Zykluszeiten und eskalieren Sie Abweichungen frühzeitig.
Schritt 4: Prävention
Sobald Stabilität und Schwung zurückkehren, konzentrieren Sie sich darauf, neue Probleme zu verhindern. Die abschließende Phase hilft Ihnen, die gewonnenen Erkenntnisse langfristig wirken zu lassen:
- Lessons Learned: Halten Sie fest, was im Projekt schiefgelaufen ist und welche Maßnahmen sich als wirksam erwiesen haben.
- Governance verbessern: Führen Sie regelmäßige Gesundheitschecks ein, um den Projektfortschritt kontinuierlich zu überwachen.
- Frühwarnsystem: Integrieren Sie die Warnsignale als feste Kontrollpunkte in den Prozess, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
- Kompetenzen stärken: Schulen Sie Ihre internen Teams in Planung, Risikomanagement und sauberer Architektur, damit sie künftige Projekte sicher steuern können.
- Schrittweise Kulturveränderung: Führen Sie eine Kultur ein, in der kontinuierliche Verbesserung, Selbstkorrektur und klare Verantwortlichkeiten zum Alltag gehören. So bleibt Ihre Organisation langfristig widerstandsfähig
Softwareprojekt gescheitert? Retten Sie Ihre Lösung mit Andersen
Wenn Sie merken, dass Ihr Projekt nicht mehr alleine zu retten ist, können Sie auf unsere Unterstützung zählen. Gemeinsam mit den Experten von Andersen entwickeln Sie eine Rettungsstrategie und setzen die notwendigen Schritte konsequent um.
Wir wissen genau, wie die Rettung von Softwareprojekten gelingt. Unsere Experten helfen Ihnen, die Vorteile der Individualsoftware voll auszuschöpfen. So erzielen Sie langfristige und nachhaltige Ergebnisse.